
Der Glaube an die Weltmaschine
Zur Aktualität der Kritik Hugo Dinglers am physikalischen Weltbild
von Holm Tetens
Quelle:
TETENS, H. (1984): „Der Glaube an die Weltmaschine - Zur
Aktualität der Kritik Hugo Dinglers am physikalischen
Weltbild“, aus: Janich, P. (Hrsg.): „Methodische
Philosophie - Beiträge zum Begründungsproblem der exakten
Wissenschaften in Auseinandersetzung mit Hugo Dingler“,
Bibliographisches Institut Mannheim, Wien, Zürich
Am Ende seines Wissenschaftlerlebens zieht der Physiker Max Born
ein Fazit der Naturwissenschaften, das vernichtender kaum hätte
ausfallen können: „Die poltischen und militärischen
Schrecken sowie der vollständige Zusammenbruch der Ethik, deren
Zeuge ich während meines Lebens gewesen bin, sind keine Symptome
einer vorübergehenden, sozialen Schwäche, sondern eine
notwendige Folge des naturwissenschaftlichen Aufstiegs“ [1].
Zu den „politischen und militärischen Schrecken“, die Max Born so eng mit den Naturwissenschaften verbunden sieht, sind inzwischen unübersehbar die ökologischen Bedrohungen hinzugekommen. Und dieses Syndrom des Schreckens hat die Wissenschaften in eine gesellschaftliche Autoritätskrise gestürzt, die jeder unmittelbar erleben kann, der schon einmal in einer Bürgerinitiative gegen Kernkraftwerke oder Aufrüstung mitgearbeitet hat.
Aber noch erstaunlicher ist es, daß Born ganz ausdrücklich für den „Bruch in der menschlichen Zivilisation“ die „Entdeckung der naturwissenschaftlichen Methode“ verantwortlich macht [2]. Worin besteht denn diese Methode, wann wurde sie denn „entdeckt“ und womit wurde denn da „gebrochen“?
Bei der Beantwortung dieser Fragen wollen wir bei der Physik bleiben, hat sie doch den anderen Naturwissenschaften methodologisch den Weg gewiesen. Das methodologisch Bahnbrechende der „neuen“ Physik aber war und ist das messende Experiment. Dies wurde zwar nicht „entdeckt“, wie Born sich ausdrückt, wohl aber methodologisch konzipiert, philosophisch reflektiert und wissenschaftspolitisch durchgesetzt gegen konkurrierende Weisen der Naturerfahrung in jener großen Umbruchsphase zwischen dem Spätmittelalter und der Neuzeit [3]. Einer von denjenigen, die Pionierarbeit dabei leisteten, die Konzeption einer quantifizierenden Experimentalwissenschaft zu entwerfen und als neuen Erfahrungstypus zu propagieren, war Roger Bacon. Von ihm lesen wir bei Friedrich Wagner, der Bacon zum Teil wörtlich zitiert: „Er hat als erster das systematische Experiment und das Quantifizieren in die Naturwissenschaft eingeführt, indem er diese auf das Prinzip der Reduktion der Qualität auf die Quantität, der Abstraktion und Isolation der Erscheinungen und auf das Experiment begründete, wenn er auch selber noch kaum zu messen verstand. . . . Als Mittel zur Macht über die Natur, ja als Mittel zur Macht schlechthin, gewinnt sie den höchsten Stellenwert unter den Wissenschaften. ... In einem Weltenaugenblick, in dem die Reichskircheneinheit des Mittelalters im Interregnum zerfiel und ein neuer Mongoleneinbruch Europa zu überfluten begann, riet Roger Bacon dem Papst, ..., die Welt durch diese Wissenschaft zu missionieren und dann durch sie seine Weltherrschaft zu errichten. Da er die Endzeit schon in den Tataren heraufkommen sah als den Vorboten des Antichrist, der seinerseits droht, durch neue Wissenschaft die Erde zu unterwerfen, müsse die Christen in Bacons Sicht schon um ihrer Notwehr willen ein Wissen beherrschen, das ihnen Reichtum und jene Waffen schenkt, die ihnen die Weltherrschaft sichern“ [4].
Welche Visionen einer unentrinnbaren Vernichtungsmaschinerie beflügelten die ersten methodologischen Entwürfe einer ExperimentaIwissenschaft noch bevor diese dann in die Tat umgesetzt wurde! „Bacons Vernichtungswaffen sind nur für den Kampf gegen die Ungläubigen bestimmt . . . Dies gilt für seine Verbrennungsspiegel, die ganze Heere und Städte vernichten, wie für jene Kombination von Strahlenwaffen mit „biologischen“ Gift- und Verseuchungswaffen, die durch ihre Wolken von Gift und Verseuchungsstoffen den Gegner vernichtend, eine Vorwegnahme der modernsten Kampfmittelkombinationen sind. Es gilt vor allem für seine biologischen Zukunftwaffen, die durch die Luft in die Physis der Völker eingreifen und „ohne Zwang“ deren Willen lenkend über „die Seelen wirksam verfügen“, so daß die Menschen Sitten, Leidenschaften und Willensregungen ändern nach eines Andern Willen - und zwar nicht nur Einzelne, sondern ganze Heere, Städte und ganze Bevölkerungen [5]“.
„Wissen ist Macht“, und naturwissenschaftliches Wissen ist Macht über die Natur. Francis Bacon, der philosophische Herold dieser neuen Definition von Wissen. wußte und sprach es deutlich aus, daß man für die Gewinnung eines solchen Wissens aus methodischen Gründen von Anfang an nicht auf verändernde Eingriffe in natürliche Prozesse verzichten und man sich dabei wohl kaum auf das damals ja noch mehr oder weniger geltende Erkenntnisideal der klassisch-antiken Philosophie berufen konnte, das Bacon selber als „felicitas contemplativa“ charakterisierte. Nein, Bacon versuchte den Affront gegen die „Philosophie der Alten“ nicht zu vertuschen, er sprach die handwerkliche Grundlage des Experiments offen als „vexatio artis“, als „Mißhandlung der Natur“ an [6].
Ist es nicht in der Tat auffällig, daß bei der Reflexion auf die experimentelle Methode in der Physik sofort Begriffe wie „Macht über die Natur“, „Mißhandlung der Natur“, „Maschine“, „Vernichtungsmaschinerie“ fallen? Liest sich das nicht wie eine Bekräftigung der erstaunlichen Altersbemerkungen von Born?
Werfen wir einen Blick auf das gängige Selbstverständnis der Physiker selber und auf die vorherrschende Wissenschaftstheorie der Physik. Nun, dort hört sich das weniger gefährlich und dramatisch an, die Wissenschaftswelt ist dort in Ordnung, deuten doch die Physiker ihre Tätigkeit so:
- die Physik dient dem Ziel, die Natur an sich zu beschreiben und dadurch zu erklären, daß die in ihr herrschenden Gesetzmäßigkeiten aufgedeckt werden; - von diesem Ziel her sind die Physiker „reiner Wahrheitssuche“ allein verpflichtet; - die Technik hingegen ist eine methodisch nicht von vornherein in der Physik angelegte, vielmehr nachträgliche Anwendung „reiner“ Forschungsergebnisse der Physik und anderer Naturwissenschaften.
Die Wissenschaftstheorie, die diese Physikdeutung unterschreibt, schweigt sich auffallend aus über das Experiment. Nicht daß sie es vergäße zu betonen, daß die Physik eine Experimentalwissenschaft ist, aber doch hält sie sich mit Vorliebe in einem „platonischen Ideenhimmel“ mathematischer Strukturen auf, und nur selten findet sie den Weg zurück in die „Niederungen“ der Experimentiertechnik. Das war schon früher so ähnlich: die Handwerker und Künstleringenieure der beginnenden Neuzeit redeten in ihren Schriften angesichts des fortbestehenden Legitimationsdruck durch das Theorieideal der klassischen Philosophie immer etwas taktisch. „Bis in das 17. Jahrhundert hinein werden die Hinweise auf eigene Versuche und kontrollierte Beobachtungen mit Entschuldigungen eingeführt, und die von Handwerkern und lngenieuren verfaßten Traktate werden in der Regel mit Entschuldigungen über die Unfähigkeit zu klassischer Begrifflichkeit und Argumentation eingeleitet.“ [7]
Der wissenschaftsideologische Grund dafür, das Experiment etwas schamhaft zu übergehen, um den tatsächlichen Bruch der experimentellen Methode mit dem klassischen Erkenntnisideal und seinem Wahrheitspathos vergessen zu machen, hat sich bis in unsere Tage forterhalten und hat dazu geführt, daß das Experiment in den wissenschaftstheoretischen Analysen ein Kümmerdasein fristet. Denn kann man sich weiterhin auf das klassische Erkenntnisideal berufen, so kann man trotz der Experimentiertechnik einen methodologischen Hiatus zwischen „reiner“ naturwissenschaftlicher Forschung und ihrer „nachträglichen“ Anwendung in der Technik aufreißen, der wiederum reine Naturwissenschaft von der Mitverantwortung für alle „negativen Folgen“ der Technik entlastet.
Fragen wir danach, wie es denn gelingt, das Experiment dem klassischen Erkenntnisideal einzuverleiben, sehen wir, daß dem eine Deutung zupaßkommt, die das Experimentieren als ein nicht veränderndes Beobachten und die dabei verwendeten Apparate als bloße Verlängerungen der natürlichen menschlichen Sinnesorgane zu Naturobjekten verfälscht. Ich kann hier nicht darauf eingehen, wie ein Konglomerat aus klassisch-griechischer Erkenntnismetaphysik und neuzeitlichem Empirismus tatsächlich eine solche Deutung des Experiments zustande bringt. Ich will mich auf ein suggestives Bild beschränken: Alle experimentellen Handlungen unter Zuhilfenahme von Apparaten werden in ihrem Verhältnis zum „eigentlichen Erkenntnisakt“ damit verglichen, wie sich das Aufsetzen einer Brille zum Lesen in einem Buch verhält. Um im „Buch der Natur“ zu lesen, setzen wir uns eben eine mathematisierte Apparatebrille auf. Und, bleiben wir einmal im Bild, solange wir forschen, blättern wir nur immer wieder eine neue Seite auf. Erst wenn wir Technik machen und industriell produzieren, kritzeln wir eigene Veränderungen in das Buch und geben es immer unleserlicher an die nächste Generation weiter.
Aber stimmt das überhaupt, daß das Funktionieren unserer technischen Artefakte methodisch vorgängig die Kenntnis der „Gesetzmäßigkeiten in der Natur“ voraussetzt? Zur Antwort möchte ich eine These formulieren und in freiem Anschluß an ähnliche Überlegungen DingIers begründen:
Aus methodischen Gründen kann die Physik einer Orientierung auf Apparate gar nicht entraten. Die mathematisierten Gesetzesaussagen in der Physik werden methodisch primär am Studium von Apparaten gewonnen und gelten uneingeschränkt auch nur von ihnen. Das an Apparaten gewonnene Wissen wird erst danach dazu herangezogen, hypothetisch-modellhaft Naturerscheinungen außerhalb der Laboratorien zu erklären und vorherzusagen.
Die faktische Geschichte der Physik duldet
kaum einen Zweifel, daß ein Großteil der Physik ausschließlich
als Laborphysik entstanden und das zutage geförderte Wissen ein
Wissen von Apparaten ist [8]. Aber selbst, wenn man die
Geschichte nicht für beweiskräftig hält und sich auf den
gängigen Standpunkt der Physiker stellt, wonach sie zwischen
einer „abhängigen“ Meßgröße m' und
„unabhängigen“ Meßgrößen
m1,....,m n Gleichungen der Form m' = f(m1,....,mn)
durch Messung nachzuweisen versuchen, selbst dann wird man aus
systematischen Überlegungen heraus auf die Apparate als den
methodisch primären Geltungsbereich physikalischer Sätze
geführt.
Physiker können nämlich keineswegs den
funktionalen Zusammenhang
m' = f(m1,....,mn) an beliebigen Orten in
einer unpräparierten Natur deskriptiv nachmessen. Solche
„Gesetze“ gelten nur unter einschränkenden
Bedingungen, die entweder in der Natur so selten anzutreffen
sind, daß die Physiker nicht auf ihr Eintreffen warten können,
ohne den Fortgang der Forschung hinauszuzögern, oder die in der
Natur überhaupt nie gegeben sind. Das Gesetz vom Auftrieb gilt
nur in ruhenden Flüssigkeiten, Fall- und lnduktionsgesetz
nur im Vakuum, die Hauptsätze der Thermodynamik
nur in abgeschlossenen Systemen. Energetisch
abgeschlossene Systeme oder das Vakuum aber sind gerade künstliche
Bedingungen, für die der Physiker selber sorgen muß und mit
deren Herstellung er sich bereits mehr oder weniger von den
Verhältnissen in der noch nicht veränderten Natur entfernt. Der
Ort wo es gelungen ist, solche Bedingungen hinreichend gut zu
realisieren, ist eben das Labor, und schon deshalb ist die
Physik zunächst einmal Laborphysik [9].
Die künstlichen Bedingungen, die der Physiker durch technisches Handeln reproduzierbar selber hervorbringt, laufen darauf hinaus, das komplexe und unübersehbare Bedingungsgefüge, das „draußen“ in der Natur vorherrscht, soweit auszuschalten, daß es den Zusammenhang m' = f(m1,....,mn) nicht mehr stören kann. Was heißt es aber, daß die „Gesetze“ der Form m' = f(m1,....,mn) in den Vorgängen der Natur gestört und nur überdeckt „wirksam“ sind, im Labor dagegen ungestört?
Ungestört ist der funktionale Zusammenhang zwischen Meßgrößen m1 bis mn und einer Größe m' genau dann, wenn unter reproduzierbaren Bedingungen eine Veränderung der Größen m1 bis mn (zumindest in einem gewissen Intervall) hinreicht, damit sich auch die Größe m' ändert. Darin besteht der eigentliche Sinn eines Gesetzes. Der Physiker mißt ja nicht einfach Werte für die Größen m1 bis mn aus, um anschließend den Wert der Größe m' zu bestimmen, woraus er tabellarisch angeordnete Meßtabellen erhält, für die er eine darstellende reell-analytische Funktion f sucht. Vielmehr ändert er selber willkürlich die Größe m1 bis mn und mißt daraufhin die Veränderung der Größe m'.
Jedes Experiment wird eben durch experimentelle Handlungen in Gang gesetzt, durch die Größen willkürlich verändert werden. Die Physik ist nicht nur Laborphysik, wo Erfahrungen unter künstlichen Bedingungen gemacht werden, sondern sie ist auch methodisch zwingend Experimentalphysik, wo untersucht wird, welche willkürlichen Anfangsveränderungen von Seiten des Experimentators welche anderen Veränderungen nachsichziehen.
Das folgende Schema eines Experiments verdeutlicht noch einmal den enormen Handlungsanteil an dem Wissen, auf dem unsere Kenntnis der sogenannten Naturgesetze beruht.

Dingler vergleicht nun die willkürliche Veränderung der Werte von m bis m mit der Betätigung einer Taste oder eines Schalters. „Ebenso wie wir einen Schalter umdrehen, um das elektrische Licht unserer Lampe anzuzünden, oder wie wir auf die Taste unseres Klaviers drücken, um einen bestimmten Ton zu erzeugen, suchen wir in der Natur diejenigen „Schalter oder Tasten“, deren Bewegungen die von uns sonst gewünschten Veränderungen hervorbringen“ [10]. Das scheint zunächst nur eine griffige Metapher zu sein, aber sie ist mehr als das. Denn der Physiker bearbeitet nicht allein dadurch ein „Stück Natur“, indem er die Meßgrößen m1 bis mn willkürlich selber auf bestimmte Werte einstellt, sondern da sich ja das Experiment beliebig wiederholen lassen soll an diesem „Stück Natur“, wird er es sogar soweit vorbereiten, daß ihm wenige Handgriffe genügen, um an ihm wieder holt die Meßgrößen auf beliebige Werte zu bringen. Ein solchermaßen bearbeitetes „Stück Natur“, daß es gewisse konstante Eigenschaften besitzt, die die Wiederholung gewisser Vorgänge erlauben, ist nicht in einem übertragenen, sondern in einem ursprünglichen Wortsinn ein Apparat zu nennen. „Wir können definieren als „Apparat“ eine Gesamtheit von konstanten Umständen zwecks Ausführung eines Experiments. Es ist dies ja der Sinn des Wortes apparatus, das Vorbereitete. Es sind hier also die wichtigeren Umstände eines Vorgangs in stets gebrauchsfertiger Weise und in zeitlich möglichst unveränderlicher Form vorhanden, um das Experiment auszuführen.“ [11]
Eine systematische Betrachtung der experimentellen Methode legt somit einen methodisch erzwungenen Grund für das historische Faktum frei, daß die Physik ihre theoretischen Ergebnisse vor allem dem Studium von Apparaten verdankt. Es wurden und werden nicht erst Gesetze der Form m' = f (m1 ,.... mn) „in der Natur entdeckt“, um anschließend in Kenntnis dieser Gesetze Apparate zu konstruieren. Vielmehr geht der Physiker methodisch so zu Werke, daß, wenn er ein Gesetz aufgrund seiner Experimente behaupten darf, er auch bereits über mindestens einen kopierbaren Apparat verfügt, der das Gesetz „rein und ungestört“ erfüllt oder realisiert, So gehören methodisch unabtrennbar zum Pendelgesetz ein Pendel, zum Fallgesetz eine schiefe Ebene im Vakuum, zum Hookeschen Gesetz eine Feder, zum Gravitationsgesetz die Drehwaage von Cavendish usw. Von den Apparaten gelten die sogenannten „Naturgesetze“ nicht als bloß hypothetisch-deskriptive Erklärung ihrer Funktionsweise, sie sind normativ-konstruktive Funktionsbestimmungen. Es wird nämlich zwischen gestörtem und ungestörtem Funktionieren gerade anhand des Gesetzes unterschieden: Störungen sind Abweichungen vom Gesetz.
„Unsere bisherigen Ergebnisse zeigen uns aber, daß man diese wunderbare Tatsache, daß man aus einzelnen Experimenten allgemeine Naturgesetze entnehmen kann, auf völlig nüchterne Weise zu erklären vermag, . . . Wir haben ja erkannt, daß Träger solcher Gesetze in erster Linie die von uns selbst hergestellten Apparate und Messungsapparate sind.“ [12]
Störungsfrei jedoch funktioniert ein Apparat nur unter gewissen Bedingungen und in einem gewissen Intervallbereich der beteiligten Meßgrößen, unter anderen Bedingungen und außerhalb des lntervallbereichs ist er nicht selten gestört. Nun gehen Störungen gerade von solchen natürlichen Bedingungen und Vorgängen aus, die wir noch nicht „in unsere Apparate eingefangen und isoliert“ (Dingler) haben. Physiker suchen in einem solchen Fall nach einem Wissen darüber, wie man Störungen ausschalten und beseitigen kann. So haben etwa farbige Ränder an Linsen, die die Beobachtungen mit optischen Geräten beeinträchtigen, den Anstoß gegeben zu Fragestellungen, die auf wichtige theoretische „Gesetze“ der Optik führten [13], oder wurden die Hauptsätze der Thermodynamik aufgestellt im Zusammenhang mit Bemühungen, Prozesse zu koppeln und den Wirkungsgrad dabei zu optimieren. Jedenfalls bedienen sich die Physiker bei dem Versuch, Störungsbeseitigungswissen [14] zu entwickeln, wieder der experimentellen Methode, so daß zugleich mit Gesetzen für solche Störungen auch Apparate oder verbesserte Versionen der ursprünglichen Apparate zur Hand sind, die diese Gesetze funktional erfüllen.
Natur macht sich also immer wieder als Störung in unseren Laboratorien und an unseren Apparaten bemerkbar. Doch bleibt unbestritten, daß natürliche Phänomene partiell erklärt werden mit dem über unsere Apparate Laborwissen oder umgekehrt natürliche Phänomene, die wir außerhalb der Laboratorien in der Natur beobachten, uns veranlassen, sie im Labor „nachzubauen“ und auf Apparaten zu simulieren. Aber erst wenn eine solche modellhafte Maschinensimulation geglückt ist, gilt das Phänomen als theoretisch erklärt.
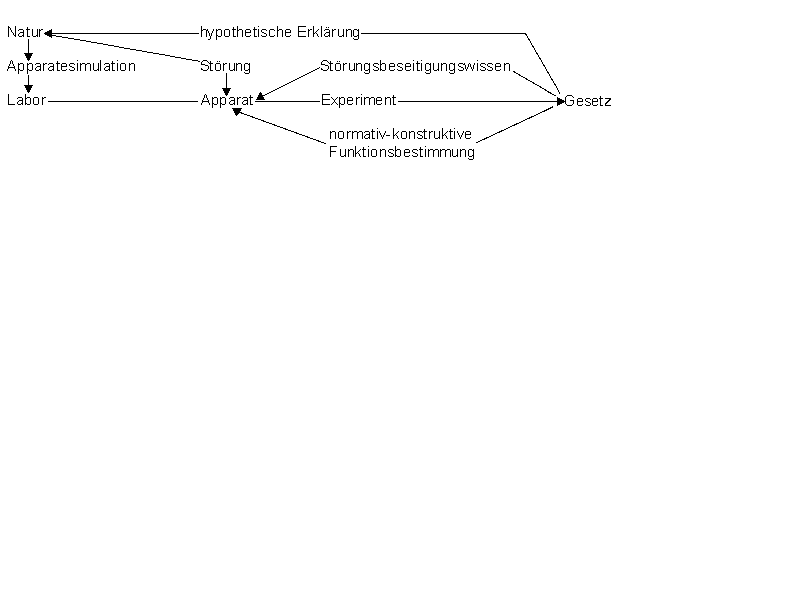
Unsere systematische These wirft ein bezeichnendes Licht auf die Physik. Sind nämlich Apparate der methodisch primäre Gegenstandsbereich der Physik, so laßt sich die oben skizzierte gängige Physikdeutung nicht halten. „Ich denke, die krankhafteste Auffassung der Physik, selbst wenn ein Gelehrter sie hat, ist die, daß die Physik die Wissenschaft von Massen, Molekülen oder vom Äther ist. Die gesündeste Auffassung hingegen, auch wenn ein Gelehrter sie sich nicht ganz zu eigen zu machen vermag, ist die, daß Physik die Wissenschaft von den Mitteln ist, die Körper in unsere Gewalt zu bekommen und sie in Bewegung zu setzen.“ [15]
Das Mittel, mit denen wir die Natur „in unsere Gewalt bringen und in Bewegung setzen“, sind die Apparate und Maschinen. Natur verstehen wir in der Physik gerade so weit, wie wir sie in Apparaten „nachbauen“ oder sie nach dem Modell einer Maschine zu erklären vermögen. So impliziert die Physik methodisch eine Maschinenauffassung der Natur. Und diese Auffassung wird zum mechanischen oder physikalischen Weltbild universalisiert. Für dieses Bild jedoch beansprucht die Physik eine realistisch-ontologische Geltung.
Genau hier setzt Dingler mit seiner Kritik an dem „Glauben an die Weltmaschine“ [16] ein. Er weist den realistischen Geltungsanspruch des physikalischen Weltbildes zurück. Die Physik enthüllt uns nicht, wie die Natur an sich ist. Bei genauerer Betrachtung folgt aus der Physik lediglich eine handlungsrelevante, methodologisch induzierte Fiktion, mit der Natur so umzugehen, als ob sie nichts anderes als eine nach festen Gesetzen ablaufende Maschine wäre. Was aber bringt ein solcher Umgang mit der Natur mit sich?
Im Labor werden die komplexen Bedingungsgefüge mit rückgekoppelten Kreisläufen der Natur ersetzt durch wesentlich vereinfachte, linearisierte und ideale Bedingungen. Deshalb sind unsere Apparate, werden sie dann außerhalb der Laborbedingungen verwendet, so oft gestört und richten selber ökologischen Schaden an, weil ihre „Neben“wirkungen auf ökologische Gesamtgefüge unter den unrealistisch vereinfachten Laborbedingungen gar nicht zum Vorschein kommen können. Da wir Natur nicht einfach im Labor imitieren, tragen die sogenannten Naturgesetze ihren Namen ganz zu Unrecht. Würden wir sie, was methodologisch viel gerechtfertigter wäre, Apparategesetze nennen, würde bei uns viel eher das Bewußtsein dafür wachgehalten, daß unsere „natur“wissenschaftlichen Laborresultate in einem tendenziellen Widerstreit zur Natur „draußen“ stehen.
Weiter sehen wir, daß Natur in der Laborphysik viel weniger als Vorbild denn als Störung und Widerstand gegen unsere apparativen experimentellen Vorhaben thematisch wird. Solchen Störungen begegnen wir bereits im Laboratorium auf eine Weise, die auch in der Technik und der industriellen Produktion gang und gäbe ist: wir greifen noch stärker in die Natur ein, schaffen weitere künstliche Bedingungen und beschwören so nicht selten neue Schwierigkeiten herauf.
Schließlich müssen wir auf vorgefundene, noch unbearbeitete Körper und Materialien zurückgreifen, aus denen wir unsere Apparate bauen. Natur ist daher auch eine, schon wegen der methodischen Forderung der beliebigen Reproduzierbarkeit aller Experimentierergebnisse für unbegrenzt gehaltene Ressource, eine Vorratskammer, aus der wir uns beliebig herausnehmen und herausschneiden, was wir jeweils benötigen. So dominiert über die methodisch ausgezeichnete Stellung der Apparate ein Naturverständnis und ein Naturumgang in den an der Physik orientierten Wissenschaften, demgegenüber die angeblich erst Schaden anrichtende „nachträgliche Anwendung“ von Forschungsergebnissen in Produktion und Technik nichts prinzipiell Neues mehr ins Spiel bringt. Hier wird wiederholt und in großen Dimensionen fortgesetzt, was bereits in den Labors an der Tagesordnung ist. Zu Recht meint daher Klaus Meyer-Abich, daß „das Erkenntnisideal der Wissenschaft mit dem Produktionsideal der industriellen Wirtschaft übereinstimmt“ [17].
Die aufsteigenden neuzeitlichen Naturwissenschaften lösten sich denn auch ab von dem Naturverständnis, unter dem die klassisch-antiken Erkenntnisideale noch weitgehend standen. Natur als „physis“ meint jetzt nicht mehr das Sein der Dinge und Lebewesen, sondern schlicht deren bloße Ansammlung, aus der wir uns beliebig etwas „herausschneiden“ [18]. Natur als „physis“ meint nicht mehr normativ das, was „zum Besten“ seiner in ihm schlummernden Möglichkeiten „gewachsen“ ist, sondern etwas, das wir erst mit unseren Apparaten für menschliche Maße perfektionieren müssen. Erst die „Weltmaschine“ ist die „beste aller möglichen Welten“.
Gernot Böhme hat an dem Beispiel der Geburtshilfe diesen Übergang zu einem anderen Naturverständnis illustriert, das mit den Naturwissenschaften heraufgezogen ist. Dieses Beispiel ist zudem deshalb bezeichnend, weil es zusätzliche soziale Herrschaftsmomente beleuchtet, die gerade von Männern gerne totgeschwiegen werden, ging doch die „Verwissenschaftlichung der Geburtshilfe“ damit einher, daß die Frauen die Geburtshilfe an den professionellen Ärztestand abtreten mußten. „Geburt war für die Hebammen Natur im Sinne der griechischen Physis-Vorstellung: Natur ist das, was von selbst geschieht, das Aufgehende, das sich Zeigende. Entsprechend war Geburtshilfe im Sinne der Hebammen nur Hilfe im eigentlichen Sinne, d.h. Unterstützung, Zusehen, Zuwarten, Hilfe beim Aushalten der Natur. Den Hebammen war durch die Hebammenordnungen explizit die aktive Beschleunigung oder Herbeiführung der Geburt, etwa durch wehentreibende Mittel, verboten, ebenso wie der Gebrauch von Instrumenten. Demgegenüber bezieht sich die wissenschaftliche Geburtshilfe auf die Geburt als einen Prozeß, den man hervorbringen kann, und dessen Bedingungen und dessen Ablauf man kontrollieren kann und muß. Für die Theoretiker der programmierten Geburt gibt es Natur im Sinne von das „Gegebene“ überhaupt nicht mehr. Vielmehr gibt es nur unterstellte Optimalitäten. Die wissenschaftliche Geburtshilfe hat wie die Naturwissenschaft überhaupt die Natur von Auffälligkeiten her thematisiert, von den Effekten, von den Phänomenen, die eine Erklärung verlangten. . . . . . So entwickelte sich die medizinische Geburtshilfe als „Störungsvermeidungswissen“ (Janich, 1973).“ [19]
Der neuzeitlich-abendländische Typus einer mathematisierten, experimentellen Apparatewissenschaft stieg keineswegs deshalb zum dominanten Erfahrungstyp auf, weil, wie Dingler zu Unrecht unterstellt, ein kulturinvarianter, „ewig menschlicher Wille zu absoluter Eindeutigkeit und Sicherheit“ anthropologisch-zwangsläufig die Oberhand gewinnen mußte, Der Aufstieg der Naturwissenschaften vollzog sich unter dem erdrückenden Primat eines Herrschaftsinteresses an Kontrolle über Natur und Mensch, das sich auf spezifische Weise erst in der bürgerlichen Gesellschaft voll ausbildete. Nicht der ,reine Verstand', nicht der ,reine Geist' entwarf zu Beginn der Neuzeit - lange vor seiner Durchführung in Physik, Chemie, Biologie, Psychologie, Soziologie usw. - das gewaltige Programm einer allseitigen mechanischen Natur- und Seelenerklärung, sondern der auf die Natur zielende neue Macht- und ArbeitswiIle einer neu aufsteigenden Gesellschaft, welcher einerseits die in der Feudalzeit und -gesellschaft vorherrschende Wertschätzung der Herrschaft des Menschen über den Menschen und das Organische -...-, wie andererseits den kontemplativen Erkenntniswillen einer priesterlichen und mönchischen Gesellschaft, Wesen und Formen der Welt zu erfassen und im Geiste abzuspiegeln, langsam zu verdrängen begonnen hatte“ [20]. Lewis Mumford hat im „Mythos der Maschine“ dargelegt, wie die militärische und paramilitärische Organisation großer Arbeitsheere in den antiken Sklavenhalter-Gesellschaften bereits das Vorbild abgab für die Maschine als Instrument der Kontrolle über Natur und Mensch [21].
Damit schließt sich der Kreis. Die „militärischen und politischen Schrecken“, von denen Born sprach, aber auch die ökologischen Gefährdungen sind uns in unserer kurzen historisch-systematischen Betrachtung der experimentellen Methode nie ganz aus den Augen entschwunden. Hat Born mit seinen tief pessimistischen Ansichten über die „Entdeckung der naturwissenschaftlichen Methode“ Recht?
Er meint, die Naturwissenschaftler seien sich ihrer Grenzen nicht bewußt. In der Tat, es kommt heute darauf an, die Grenzen des Physikalismus, der Universalisierung des Maschinenparadigmas zu erkennen. Dinglers Verdienst liegt darin, daß er mit seiner methodischen Philosophie der Physik den Boden für eine solche Diskussion bereitet hat. Gerade indem er unerschütterlich an der methodischen Ordnung in der Physik festhält, kann er Wichtiges dazu beitragen, eine realistisch-ontologische Deutung des Physikalismus zu kritisieren und den Blick dafür zu öffnen, daß hier in Wahrheit zweckgebundene methodische Entscheidungen zur Diskussion stehen. Nur wenn eine Diskussion über die Zwecke und die methodischen Maßnahmen der Physik wirklich stattfindet, ist noch nicht entschieden, ob Born am Ende Recht behalten wird.
Anmerkungen
[1] Max Born, Erinnerungen und Gedanken eines Physikers, in: Universitas 23, 1968, S. 276
[2] Born, a.a.O., „Ich bin von dem Gedanken bedrückt, daß dieser Bruch in der menschlichen Zivilisation, der durch die Entdeckung der naturwissenschaftlichen Methode verursacht wurde, nicht wieder gutzumachen ist.“
[3] Eine kurze und übersichtliche Darstellung gibt etwa Wolfgang Krohn, Die „Neue Wissenschaft“ der Renaissance, in: Böhme, van den Daele, Krohn, Experimentelle Philosophie - Ursprünge autonomer Wissenschaftsentwicklung, Frankfurt 1977, besonders daraus S. 61-86
[4] Friedrich Wagner, Weg und Abweg der Naturwissenschaft, München 1970, S. 38 und S. 39/40
[5] Wagner, a.a.O., S.40/41
[6] zitiert nach Wolfgang Krohn, “Wissen ist Macht“ - Zur Soziogenese eines neuzeitlichen wissenschaftlichen Geltungsanspruchs, in: Kurt Bayertz (Hrsg.), Wissenschaftsgeschichte und wissenschaftliche Revolution, Köln 1981, S.47
[7] Wolfgang Krohn, siehe Fußnote 6), S.45
[8] Vgl. etwa Böhme, van den Daele, Krohn, Die Verwissenschaftlichung der Technologie, in: Starnberger Studien 1 - Die gesellschaftliche Orientierung des wissenschaftlichen Fortschritts, Frankfurt 1978
[9] Der Fall der Astronomie stellt diese Behauptung nicht infrage. Das Planetensystern ist nämlich die in der Natur sehr seltene Ausnahme eines fast ungestörten „Labor“systems. Zudem kommt auch die Astronomie nicht ohne Apparatewissen aus; die Gravitationskonstante kann, wie etwa Pohl in seiner Experimentalphysik dargelegt, nicht durch astronomische Beobachtungen, sondern zuerst einmal nur über Versuche mit der Drehwaage von Cavendish ermittelt werden.
[10] Hugo Dingler, Die Methode der Physik, München 1938, S. 127
[11] Dingler, Physik und Hypothese, Berlin und Leipzig 1921, S. 46
[12] Dingler, Grundriß der methodischen Philosophie, Füssen 1949, S. 63
[13] Vgl. etwa dazu Böhme, Alternativen der Wissenschaft, Frankfurt 1980, den Vergleich zwischen der Optik Newtons und der Farbenlehre Goethes, S. 123 ff.
[14] Der Ausdruck stammt von Peter Janich aus seiner Konstanzer Antrittsvorlesung „Zweck und Methode der Physik aus philosophischer Sicht“, Konstanz 1973
[15] Das Zitat stammt von W. S. Franklin, in der Zeitschrift „Science“ vom 2. Januar 1903, hier zitiert nach W. James, Der Pragmatismus, Hamburg 1977, Fußnote S. 30/31
[16] Vgl. Hugo Dingler, Der Glaube an die Weltmaschine und seine Überwindung, Stuttgart 1932
[17] Klaus M. Meyer-Abich, Zum Begriff einer Praktischen Philosophie der Natur, in: Meyer-Abich (Hrsg.), Frieden mit der Natur, Freiburg-Basel-Wien 1979, S.248
[18] „Trotzdem sie (die Naturgesetze, H. T.) aber insoweit empirisch sind, tragen sie doch den Stempel unserer Einwirkung unveräußerlich an sich. Sind sie doch erst durch die von uns geschaffenen Grundformen unserer Apparate aus der fließenden Natur herausisoliert und herausgeschnitten worden. Auch von diesen Gesetzen kann man nicht sagen. daß sie als solche in der unberührten Natur schon in abgesondertem und isoliertem Zustand vorhanden seien und darin saßen.“. Dingler, Der Glaube an die Weltmaschine und seine Überwindung, Stuttgart 1932, S.34
[19] Böhme, Alternativen der Wissenschaft, Frankfurt 1980, S. 47
[20] Max Scheler, Erkenntnis und Arbeit, abgedruckt in Scheler, Gesammelte Werke, Band 8, Die Wissensformen und die Gesellschaft, Bern 1980, S. 198
[21] Vgl. Lewis Mumford, Der Mythos der Maschine, Kultur, Technik und Macht, Frankfurt am Main 1979. Reiner Reastrup schreibt in der Zeitschrift „Wechselwirkung“ vom Mai 1981, S. 15: „Die Mechanisierung des Menschen hat sich als eine erfolgreiche Methode erwiesen, Herrschaft auszuüben. Die Erkenntnis, das dies nur über einen bewußten Eingriff in die individuelle Natur des Menschen geschehen kann, verfestigte sich im Militär zu einer bestimmten Praxis der Machtausübung und zog wiederum eine entsprechende Technik nach sich. Die Methoden und Denkweisen, die sich dabei herausbildeten, tauchen historisch verschoben in den modernen Naturwissenschaften erneut auf. Mumford beschreibt dieses Phänomen als die „Wiedergeburt der Megamaschine“. Die Natur über mechanistische Prinzipien zu erklären, findet seinen Ursprung also nicht in der Erstellung eines „mechanistischen Weltbildes“ in der Spätrenaissance, vielmehr kann die Militärorganisation als Vorbild und Wegbereiter angesehen werden“.