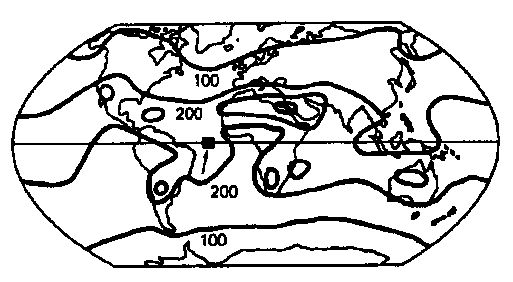
Energieversorgung im 21. Jahrhundert
Quelle:
Bölkow,
Ludwig (1987): „Energieversorgung im nächsten
Jahrhundert",
DABEI-Handbuch für Erfinder und
Unternehmer,
VDI-Verlag GmbH, Düsseldorf 1987
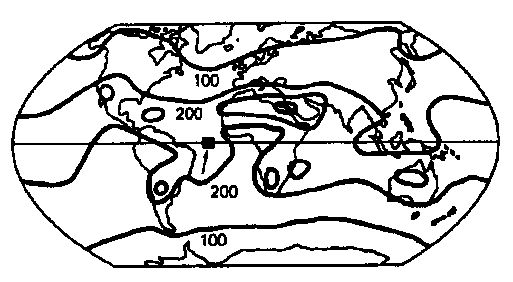
Abb. 1. Linien gleicher Sonnenintensität (W)
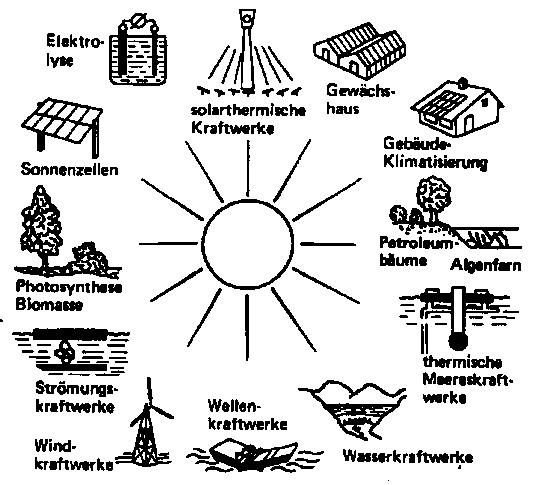
Abb. 2. Von der Sonne gespeiste Energiequellen